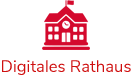Stadtchronik
Das Gebiet der Stadt Landau a.d.Isar wird zurecht als "Kern des niederbayerischen Fruchtlandes" bezeichnet, es ist uraltes Kultur- und Bauernland.
Seit sich in der Jungsteinzeit erstmals Bauern niederließen, ist der Landauer Boden fast durchgehend besiedelt. Kothingeichendorf westlich von Zeholfing ist der klassische Ort bayerischer Vorgeschichte (Kreisgrabenanlagen).
Schriftliche Aufzeichnungen zur Stadtgeschichte beginnen erst im Mittelalter.
-
nach 1110
Zahlreiche Urkunden belegen die Herren von Ahausen, ihre Burg stand auf dem heutigen Kalvarienberg. Am Fuß des Burgbergs zur Isar hin gab es zu der Zeit bereits eine dörfliche Siedlung.
-
13. Jahrhundert
1224
In den "Annales Altahenses" von Abt Hermann von Niederalteich findet sich folgender Eintrag: "Oppidum in Landaw construitur a Ludwico duce Bawarie" (Die Stadt Landau wurde von Ludwig, dem Herzog von Bayern, erbaut). Deutlich ist die Programmatik der neuen Stadt: „Landau“ ist zu deuten als „Wasserburg, die das Land schützt“, als Schutz des herzoglichen Landes, genauer gesagt, gegen die geistlichen Herrschaftskonkurrenten in Regensburg und Passau. Landau ist nach Passau, Kelheim (1181), Landshut (1204), Vilshofen (1206) und Straubing (1218) die sechstälteste Stadt Niederbayerns und kommt vor Deggendorf (1250), Dingolfing (1251) und allen anderen Städten.
1233
Der bayerische Herzog macht die junge Stadt gleich zu einem seiner Mittelzentren. Er setzte für das "Amt" Landau einen Richter als seinen persönlichen Stellvertreter ein. Landau war eines von insgesamt 34 Ämtern, in die der Herzog Otto II. sein Bayernland einteilte.
1249
Pfarrer Gozwin wird urkundlich als Dekan in Landau erwähnt. Dies lässt annehmen, dass Landau seit seiner Gründung auch Pfarrsitz ist.
1263
Die Stadt führt zu dieser Zeit bereits ein eigenes Siegel. Es ist damit das älteste aller bekannten Gemeindesiegel in Niederbayern.
-
14. Jahrhundert
1304
Die Stadt erhält von den beiden gleichzeitig regierenden Herzögen Otto III. und Stephan I. von Niederbayern die Verbriefung ihrer bisher schon ausgeübten städtischen Sonderrechte. Das Landauer Stadtrecht lehnte sich eng an das von Landshut aus dem Jahre 1279 an. Die Originalurkunde ist noch erhalten, im Gegensatz zu der von Landshut.
In den folgenden zwei Jahrhunderten entwickelte sich die herzogliche Stadt wirtschaftlich gut. Das Bürgertum gelangte durch Handel und Handwerk zu Wohlstand und Reichtum. Landau wurde zu einer bedeutenden Handelsstadt. Die Brücke über die Isar an einer verkehrsreichen Handelsstraße und der Fluss selber als vielgenützter Wasserweg trugen dazu bei. Die "große Dult" in Landau war zu der Zeit der größte Warenmarkt im Donauraum zwischen Regensburg und der Enns in Österreich. Das Landauer Getreidemaß hatte weithin seine Geltung in Niederbayern.1313
Landau hat in seinen Mauern hohe Gäste: Der oberbayerische Herzog und spätere deutsche Kaiser Ludwig der Bayer verhandelt im herzoglichen Landauer Schloss mit dem österreichischen Herzog Friedrich dem Schönen über die Vormundschaft für die unmündigen niederbayerischen Prinzen. Man ging im Zorn auseinander und traf sich in der Schlacht von Gammelsdorf wieder. Friedrich wurde geschlagen.
1335
Das "Heiliggeist-Bürgerspital" in Landau besteht bereits als Stiftung, deren Zweck ist die Versorgung der Alten und sozial Schwachen in der Stadt. Das Altenheim in der Dr. Godron-Straße ist heute noch Stiftungseigentum.
1362
Es wird vermutet, dass in diesem Jahr die "Landauer Bürgerzeche" gegründet wurde, die damit Landaus ältester Verein ist. Erst 1851 löste sie sich auf. Sie war eine genossenschaftliche Vereinigung Landauer Bürger, die eine gemeinsame Kasse gründeten, um den Mitgliedern Vorteile in religiösen Dingen Art wie Totenmessen, Gebete, Gedächtnisgottesdienste usw. zu sichern.
-
15. Jahrhundert
1481
Die "Sebastiani-Bruderschaft" wird zum Zwecke der Verehrung des Heiligen Schutzherrn der Stadt gegründet, lange vor dem bekannten Pestbrauch. Die Bruderschaft ist der älteste der zahlreichen noch bestehenden Landauer Vereine.
-
16. Jahrhundert
1504
Der 29.06.1504 ist ein schwarzer Tag für Landau: Im Landshuter Erbfolgekrieg wird die Stadt durch Brand fast vollkommen zerstört. Dabei verliert sie ihr mittelalterliches Gepräge. Götz von Berlichingen, in den Reihen der Belagerer, nannte Landau „ein faules Nest".
1558
Der Landauer Stadtpfarrer Johann Schwab wird wegen Sympathisierens mit der Lehre Luthers abgesetzt und aus der Stadt verjagt. Die Reformation ging also auch am erzkatholischen Niederbayern nicht spurlos vorbei. Es wurde in Kirchenkreisen beklagt, dass die Landauer Bevölkerung, nach Ortenburg, zu den Evangelischen „hinausläuft“.
1563
Dr. Sigmund Viehauser, ein bedeutender Sohn der Stadt Landau, nimmt als bayerischer Gesandter am Konzil von Trient teil.
Lange bestimmten die Zünfte das gesellschaftliche Leben und die handwerkliche Ordnung in der Stadt. Dazu gehörte auch die genau festgelegte Auswahl der „Handwerksgerechtigkeiten“ jeder Zunft. Demzufolge gab es in Landau 9 Bäcker, 7 Metzger und 18 (!) Bierbrauer. Folgende andere 15 Zünfte sind genannt: Fischer, Schäffler, Binder, Leinweber, Maurer, Müller, Schöffmüller (Schiffmüller), Sattler, Seiler, Schmiede, Schneider, Schuster, Tuchmacher, Wagner und Zimmerleute.
-
17. Jahrhundert
1648
Der "Dreißigjährige Krieg" endet. Durch Zahlung von 5.000 Talern an die Schweden rettete sich die Stadt Landau a.d.Isar vor Brandschatzung, Plünderung und Zerstörung.
1681
Mit dem Bau der sehr beliebten Wallfahrtskirche "Maria im Steinfelse" wird begonnen. Die Wallfahrt geht auf ein Kriegserlebnis eines Landauer Feldwebels der Landfahne in Straubing zurück.
-
18. Jahrhundert
1713
Der Neubau der heutigen barocken Stadtpfarrkirche St. Maria wird unter Stadtpfarrer Phillip Jakob Rappoltsberger in Angriff genommen. Erst eine Stiftung der Freifrau Maria Theresia von Puechleuten auf Wildthurn von über 21.000 Gulden ermöglichte das Projekt. Baumeister war Dominikus Magzin, von dem u. a. auch die Klosterkirche Aldersbach stammt. Die Kirche gilt als größte und schönste Barockkirche an der unteren Isar.
Der "Schwarze Tod" erreicht auch Landau. Innerhalb von 6 Wochen sterben 80 Personen an der Pest, sie werden im eigens angelegten Pestfriedhof außerhalb der Stadt, nahe der Heiligkreuz-Kirche, eingegraben. Einem damaligen Gelöbnis folgend findet bis auf den heutigen Tag alljährlich die Sebastianiprozession statt.
1726
Die Stadtpfarrkirche St. Maria und die Steinfelskirche werden geweiht.
1743
Die Stadt wird im Österreichischen Erbfolgekrieg in Schutt und Asche gelegt. Zwischen dem 17. und dem 19. Mai beschossen die österreichischen Belagerer die Stadt mit Feuerkugeln. Zusätzlich steckten die französischen Besatzer die Stadt auch noch selbst in Brand, um ihren Rückzug zu decken. Der Kirchturm war mit "dem schönen Geleuth ausgeprunnen, all übrige Häuser und Städl pranten völlig zu einem Aschen- und Steinhaufen zusamben". Verschont blieben nur der Kastenhof des Herzogs, der Kirchenraum von St. Maria und das Franziskanerhospiz südlich des Kastenhofs.
1750
Kurfürst Max III. Joseph, der "gute Vater Max", hilft der völlig verarmten Stadt, unter anderem durch Vereinnahmung eines Bierpfennigs von allen Brauern im Umkreis von zwei Stunden. Auch die österreichische Kaiserin Maria Theresia lässt der Stadt zum Wiederaufbau 600 Dukaten zukommen.
1796
Das blutrünstige, aber traditionelle Landauer Passionsspiel am Karfreitag wird, der Androhung von Zuchthaus zum Trotz, noch einmal aufgeführt, wenn auch zum letzten Mal. In der Zeit der Aufklärung hatte so eine "Comedi" keinen Platz mehr.
-
19. Jahrhundert
1803
Unter dem "allmächtigen" Minister Graf Montgelas werden die Landgerichte von Dingolfing und Landau zusammengelegt, Sitz ist Landau. Ein Gerichtsbezirk entsprach in etwa einem heutigen Landkreis. 35 Jahre lang waren die Dingolfinger darüber sehr verschnupft, ehe die Anordnung geändert wurde.
1825
Die Verbindungsstraßen nach Mamming und nach Frammering und Ettling werden gebaut. Landau bekommt Hinterland.
1829
Landau hat 1624 Einwohner und besteht aus 300 Häusern. Der Fortschritt und die Technik hielten Einzug in das verträumte Landstädtchen.
1840
Landau bekommt mit der Postkutsche eine "Eilpost".
1850
Die letzte hölzerne Brücke über die Isar wird errichtet, sie wird bis in das 20. Jahrhundert hinein genutzt.
1859
Die "Englische Fräulein" kommen in die königliche Bezirksstadt Landau. Sie gründen eine "Rettungsanstalt für Waisen und verwahrloste Kinder " sowie die Mädchenschule.
1863
Die Freiwillige Feuerwehr wird gegründet und damit die Brandbekämpfung organisiert.
1875
Die Bahnstrecke Plattling-Landau-Mühldorf wird in Betrieb genommen, fünf Jahre später die Hauptstrecke bis Landshut. Die Landauer versäumten es, anstelle von Plattling Knotenpunkt des niederbayerischen Eisenbahnnetzes zu werden.
1898
Die Stadt wird an das elektrische Stromnetz angeschlossen.
-
20. Jahrhundert
1900
Der Stadtrat von Landau und die Markträte von Eichendorf, Simbach und Arnstorf richten eine Petition an die „Hohe Kammer der Abgeordneten“ in München für den Bau einer Lokalbahn von Landau nach Arnstorf. Als der Eingabe entsprochen wird, herrscht in Landau Jubelstimmung. Bis zur „Jungfernfahrt“ des „Bockerls“ wird es noch drei Jahre dauern.
Die ersten Straßenlampen werden in Landau montiert. Es sind „Helios“-Lampen, die allerdings nur schwache Lichtleistung bringen.
Auf Anregung von Bezirksamtmann F. X. Bader (von 1896 bis 1900 in Landau) wurde der Marienplatz mit einer Lindenallee bepflanzt.
Der letzte Landauer Postillion Johann Baptist Steghafner geht in Ruhestand.1901
Die Telegraphenanstalt bekommt einen Morseapparat. Und Landau bekommt seine zweite Telefonstelle. Sie befindet sich in der Oberen Stadt, nachdem die Untere Stadt schon seit drei Jahren ein öffentliches Telefon hat.
Die marode Brücke über den Stadtgraben zwischen Kastenhof und der Druckerei Wegmann, beim ehemaligen „Oberen Tor“, wird durch eine neue steinerne Brücke ersetzt.1902
Der 19. Bayerische Handwerkstag findet in den Mauern der Bergstadt statt. Dabei wird der „Zentral-Handwerker-Genossenschafts-Verband“ aus der Taufe gehoben. Aus ihm ist der jetzige Bayerische Genossenschaftsverband hervorgegangen. Die Landauer Handwerker werden ausdrücklich zur Gründung einer örtlichen Handwerkergenossenschaft ermutigt.
1903
Die Eisenbahnbrücke über die Isar, eine eiserne Bogenbrücke ohne Pfeiler, wird über die Isar gespannt und hält der Belastungsprobe von mehreren Lokomotiven stand. Die Lokalbahn, das „Bockerl“, Landau – Arnstorf wird eröffnet.
Im September beruft der hiesige Bader Valentin Wegmann eine Versammlung in den Kiendl- Saal am Marienplatz ein, mit dem Zweck, eine freiwillige Sanitätskolonne in Landau zu gründen. Er selber wird 2. Vorsitzender, Andreas Marb, der spätere Bürgermeister, wird 1. Vorstand.1904
Gehsteige gibt es jetzt auch in der Unteren Stadt.
Auf der neu eröffneten Bahnstrecke Landau - Arnstorf werden in diesem Jahr 34.000 Tonnen Güter transportiert sowie 94.000 Fahrgäste befördert.
In der Nacht zum 18. November bricht im Brauhaus der Großbrauerei Franz Grandl (heute Krieger) ein verheerendes Feuer aus und äschert die Gebäulichkeiten bis auf die Grundmauern ein. Kurz darauf entsteht an gleicher Stelle das jetzige Brauereigebäude.1905
Die „Handwerker-Kreditgenossenschaft Landau a.d.Isar“, die spätere Volksbank, steigt ins Bankgeschäft ein.
Im Bürgerspital Landau treten die Barmherzigen Schwestern ihren Dienst an und versehen ihn bis zum Umzug des Spitals in das neue Haus in der Dr.-Godron-Straße im Jahre 1986.
In der Unteren Stadt wird das vom renommierten Architekten Ganzenmüller konzipierte Brauereigebäude fertiggestellt. Es ist die Braustätte für den Grandl-Bräu und später für den Krieger-Bräu.
In Landau findet ein großes Gauturnfest anlässlich des 25-jährigen Vereinsjubiläums des Turnvereins statt, an dem 27 auswärtige Vereine teilnehmen.
Landau zählt 776 Haushalte mit insgesamt 3.308 Einwohnern.1906
Laut Magistratsbeschluss werden Platz- und Straßennamen eingeführt, ersetzen aber die fortlaufenden Hausnummern. Endgültig erst seit 1959.
1907
In den sechs Klassen der Mädchenschule besuchen 325 Schülerinnen die Werktagsschule und 126 die Feiertagsschule. Das ergibt einen Durchschnitt von 54 Schülerinnen pro Klasse.
Die eiserne Straßenbrücke über die Isar löst die hölzerne ab.1908
Der Erweiterungsbau des Knabenschulhauses in der Unteren Fleischgasse wird bezogen. Die Baukosten belaufen sich auf 38.175 Mark 56 Pfennig.
1910
Erstmals wird in Landau der Schäfflertanz aufgeführt.
Zum hiesigen Volksfest müssen Sonderzüge eingesetzt werden. Das Landauer Volksfest beweist seine Anziehungskraft.
In Landau kommt es zum „Bierkrieg“. Die Ziegeleiarbeiter in Möding treten in Bierstreik, weil der Preis für die Maß von 20 auf 24 Pfennig erhöht worden ist.1911
Prinzregent Luitpold besucht die alte Wittelsbacherstadt. Zu diesem denkwürdigen Anlass wird in Landau eine eigene Festschrift erstellt.
1912
Landau bekommt eine zentrale Hochdruckwasserleitung, die sich aber schon bald als zu klein erweisen wird.
Schloss Tannegg in Unterframmering entsteht aus dem Umbau des Bauernhofes „Am Berg“.1913
Wilhelm Krieger sen. erwirbt die Grandl-Brauerei, ersetzt sehr bald die traditionellen Holzlagerfässer durch Alu-Behälter und baut die Brauerei konsequent zu einem modernen Industriebetrieb um.
1914
Der Wochenlohn für einen guten Gesellen beträgt 5 Mark bei freier Kost und Logis.
Im Krieger-Saal im Gasthaus „Zur Post“ hat das „Kinotheater“ in Landau Premiere mit Vorführungen am Samstag und Sonntag.
Die Nachricht vom Ausbruch des I. Weltkrieges am 2. August löst in Landau große Freude aus. Schon Mitte Oktober hat die Stadt aber den ersten Gefallenen im 1. Weltkrieg zu beklagen.
Die Karriolpost (leichtes Post-Pferdefuhrwerk) fährt zum letzten Mal die Linie Landau-Oberpöring.1915
Als die Zahl der an der Front verwundeten Soldaten stark anwächst, werden öffentliche Gebäude in der Heimat als Verwundetenlazarette eingerichtet, so in Landau das 1908 fertiggestellte neue Gebäude der Knabenvolksschule.
Die Lokalbahn Landau-Arnstorf erhält von Aufhausen aus eine Abzweigung ins untere Vilstal bis Kröhstorf.1917
Zwei Glocken des Geläuts von St. Maria müssen abgeliefert werden und werden vom Turm geholt. Anstatt „Schwerter zu Pflugscharen“ zu machen, werden „Kirchenglocken zu Kanonenrohren“ gegossen.
1918
Das Kriegsende löst in der Bevölkerung Jubel und Erleichterung aus.
1919
Der SPD-Ortsverein Landau wird gegründet.
Der radikale „Bauernbündler“ Konrad Kübler zieht in das 1. bayerische republikanische Parlament ein.
Der Bürstenbindermeister Andreas Marb wird zum Bürgermeister Landaus gewählt und bleibt es bis 1934, bis die Nazis in totalitärer Weise auch auf kommunaler Ebene die Macht übernehmen.
Der 1880 gegründete Turnverein Landau hat seit Oktober auch eine Damenriege.1920
Das Postamt bekommt ein neues Amtsgebäude gegenüber dem „Sichartstadel“ (heute Teleprofi Gruber).
Arthur Piechler, bekannter Komponist aus Landau und späterer Domorganist in Augsburg, übernimmt den Dirigentenstab des hiesigen Gesang- und Orchestervereins und vier Jahre später auch das Amt des 1. Vorstands. Er ist die berühmteste Landauer Persönlichkeit des 20. Jahrhunderts und wird Ehrenbürger der Stadt.1922
In Landau wird die neue „Landwirtschaftsschule“ in der Oberen Stadt, gleich neben der Sparkasse, bezogen.
1923
Das Kriegerdenkmal am östlichen Marienplatz wird fertiggestellt. Es kostet 13,5 Millionen Inflationsmark und ist ein Werk der Landauer Bildhauer Karl und Rose von Ranson.
Im November kostet ein Tag Aufenthalt im Landauer Bezirkskrankenhaus schon 25 Billionen Reichsmark (25.000.000.000.000 RM).
Im Dezember kostet ein Pfund Rindfleisch 1 Billion 800 Milliarden Mark. Es ist der Höhepunkt der Inflation, nur Sachwerte zählen noch.1924
Im 700. Jahr seit der Stadtgründung scheitert die Idee endgültig, die Isar schiffbar zu machen.
Die Umstellung auf Goldmark macht den Landauer Geldinstituten die Kreditgewährung bis auf weiteres unmöglich.1925
Die Familie Gerhaher übernimmt die Ziegelei Möding und modernisiert sie.
1926
Die Stadt kauft für die eigene Stromerzeugung in Kiel einen Dieselmotor, der im 1. Weltkrieg ein kaiserliches U-Boot angetrieben hatte. Der Koloss von 10 m Länge und 3 m Breite muss in Einzelteile zerlegt werden, um mit der Bahn nach Landau geliefert werden zu können.
1929
Ein mächtiger Eisstoß auf der Isar gefährdet die Brücken. Man kann den Fluss auf den Eisschollen überqueren.
1930
Unter der Regie der „Förderer“ wird im Fasching eine „Zigeunerhochzeit“ veranstaltet, die riesigen Zulauf aus Nah und Fern hat. Sie wird bis in die 50er Jahre herein zur Tradition und bestätigt Landaus Ruf als Faschingshochburg in Niederbayern.
1931
Auf der Marienhöhe wird das katholische Jugendheim eingeweiht. Es ist bis zur Nazizeit ein Hort für die katholische Jugend. Nach dem Krieg wird es Jugendherberge und muss schließlich dem Schulgebäude der Lebenshilfe weichen.
1933
Am 4. März, dem Tag vor der Reichstagswahl, kommt es zu Auseinandersetzungen zwischen SA und Mitgliedern der „Bayernwacht“, die der Bayerischen Volkspartei (BVP) nahesteht. Die Bayernwachtler werden angepöbelt und ziehen sich in den Pfarrhof zurück, was Pfarrer Huber auf den Plan ruft. Er wird von den SA-Leuten verbal und tätlich massiv angegriffen.
Bei den letzten freien Reichstagswahlen im März ergibt sich folgendes Wahlergebnis für Landau: Bayerische Volkspartei 879 Stimmen, NSDAP 541 Stimmen, Bayerischer Bauern- und Mittelstandsblock 278 Stimmen, SPD 251 Stimmen und KPD 114 Stimmen.
Am 15. Mai wird der Fabrikarbeiter und Stadtrat Matthäus Kragleder wieder aus der „Schutzhaft“ der Nazis entlassen. Er hatte sich geweigert, sein Haus am 1. Mai, dem „Tag der Arbeit“, mit Hakenkreuzfahnen zu beflaggen.1936
Nach dem „Landauer Boten und Anzeiger“ muss nun auch Küblers Zeitung, das „Landauer Volksblatt“, sein Erscheinen einstellen.
Im Stadtgraben wird die erste Landauer Stadt- und Turnhalle gebaut.1937
Das „NSV-Gesundheitshaus“, das spätere Landauer Krankenhaus, entsteht in der jetzigen Dr. Godron-Straße.
Die Nazis übernehmen den klösterlichen Kindergarten.1938
Bei Beerdigungen von Mitgliedern örtlicher Vereine darf ab sofort die Vereinsfahne nicht mehr mitgetragen werden. Die Gehaltszahlungen für die klösterlichen Lehrkräfte an der Mädchenschule enden im August, sie dürfen nicht mehr unterrichten.
Eine Bedienung aus der Zeit erinnert sich an 32 Gaststätten und vier Kaffeehäuser in der Stadt.1939
Das Amtsgericht Landau bekommt an der Hochstraße ein eigenes stattliches Gebäude, nachdem es bisher im Kastenhof untergebracht war.
Ab 1. Oktober versendet Stadtpfarrer Johann Baptist Huber an Frontsoldaten aus seiner Gemeinde monatlich „Feldpostbriefe“, insgesamt 14 an der Zahl. Er wird der „offenen Hetze gegen das Regime“ bezichtigt.
Der erste Gefallene des 2. Weltkriegs aus Landau ist Richard Fuchsberger.1940
Nach einem Dammbruch bei Harburg gibt es ein schweres Hochwasser.
1942
Johann B. Huber, seit 1931 Stadtpfarrer, wird ins KZ Dachau verbracht, nach vier Monaten Inhaftierung stirbt er.
1944
Konrad Kübler wird, wie schon nach dem Hitler-Attentat 1934, erneut ins KZ eingeliefert. Nach seiner Befreiung bezeichnet er Flossenbürg als „Vernichtungslager“.
1945
Beide Landauer Brücken werden Ende April, noch kurz vor dem Anrücken der Amerikaner, von den Deutschen gesprengt. Landau soll auf Befehl der SS verteidigt werden.
Am 30. April wird das Rathaus durch amerikanischen Beschuss zerstört. Starke Zerstörungen gibt es auch in der Altstadt. Insgesamt sind 22 Tote auf deutscher Seite zu beklagen. Die in Landau eintreffenden Truppen der 3. US Army nehmen erstaunt zur Kenntnis, dass es in Landau weder einen Adolf Hitler-Platz noch eine Adolf Hitler-Straße gibt.
Die Amerikaner errichten ein provisorisches Wiesenlager im Frammeringer Moos für deutsche Kriegsgefangene und Mitglieder der Wlassow-Armee.1946
Der erste demokratisch gewählte Bürgermeister ist Konditormeister Alois Lohmeier. Kommissarischer Landrat des Landkreises Landau wird Konrad Kübler.
1947
Die Volkshochschule Landau wird gegründet, die Erwachsenenbildungseinrichtung tritt im Jahr darauf dem Bayerischen Vokshochschulverband bei.
1948
Das neue Geläut in St. Mariä Himmelfahrt wird geweiht. Es ist der erste große Auftrag für den Passauer Glockengießer Rudolf Perner, einen Flüchtling aus Böhmen.
Landau wird eine eigene evangelisch-lutherische Pfarrei. Dingolfing bleibt bis 1949 exponiertes Vikariat von Landau.
Mit der langsamen aber stetigen Zunahme des Verkehrs bekommt die Stadt ein Problem mit ihren Straßen. Bis auf ein paar hundert Meter in der Altstadt sind es ausschließlich Straßen mit Kies- oder Sandbelag.1949
Auf dem Spitalplatz wird der erste Ferkelmarkt nach dem Krieg abgehalten. Er findet in den folgenden Jahren jeden ersten Freitag im Monat statt.
Die „Verbandsmittelschule“ Landau ist die erste Mittelschule (heute Realschule) Bayerns, Dr. Viktor Karell, der „Vater der bayerischen Mittelschulen“, wird ihr erster Direktor.
Die 725-Jahrfeier des Stadtjubiläums wird in bescheidenem Rahmen begangen. Höhepunkt ist der große Volksfest-Festzug mit den Vereinen der Stadt.1950
Anstelle des 1945 zerstörten Rathauses entsteht ein Neubau.
Die motorisierte „Kraftpostlinie“ löst in der Bergstadt den zweispännigen Paketzustellwagen ab.1951
Der Grundstein für das „Flurbereinigungsamt für Niederbayern“ wird gelegt.
1952
Der Grundstein für die neue evangelische Kirche wird gelegt, anstelle des evangelischen Bethauses von 1894.
Ende August wird mit dem Bau der neuen Turnhalle gegenüber dem heutigen Volksfestplatz begonnen, ein Jahr später ist sie fertig. Schon bei Baubeginn der Turnhalle kann der großzügig angelegte Sportplatz in unmittelbarer Nähe in Betrieb genommen werden.
Bischof Simon Konrad weiht die nun wieder instandgesetzte Isarbrücke.1953
Einweihung der neuen evangelischen Friedenskirche durch Oberkirchenrat Koller aus Regensburg, den Vater eines späteren Landauer Pfarrers.
Die seit 1949 bestehende staatliche Mittelschule erhält ein modernes Schulgebäude links der Isar. Sie steht Jungen und Mädchen gleichermaßen offen, diese werden aber weiterhin in getrennten Klassen unterrichtet.
Im Herbst werden die umfangeichen Außenrenovierungen der Steinfelskirche unter Konservator Fritz Blum abgeschlossen.1954
Die Errichtung einer staatlichen Oberrealschule für Landau wird vom Stadtrat beantragt. Sie soll an die Mittelschule angebaut werden und ein eigenes Internat erhalten. Aber erst 15 Jahre später wird Landau sein Gymnasium erhalten, jedoch an anderer Stelle.
Am Plan, in Landau eine Zuckerfabrik zu errichten, wird fieberhaft gearbeitet. Die Erhebung von Anbauflächen im Einzugsgebiet Landau umfasst die Landkreise Landau, Dingolfing, Vilshofen, Eggenfelden, Pfarrkirchen, Griesbach, Deggendorf, Straubing, Vilsbiburg, Landshut, Mallersdorf und Bogen und bringt die vom Ministerium geforderte Anbaufläche von 8000 ha. Die Fabrik soll am Bahnhof entstehen. Die B 20 als Nord-Südachse sei bei der Standortwahl ein großes Plus für Landau, wird argumentiert. Letztlich setzt sich aber Plattling als Standort durch.
Beim „Jahrhunderthochwasser“ der Isar wurden in Landau 419 Schadensfälle mit einer Schadenssumme von 750.000 DM gemeldet.
Der Stadtbauhof wird auf dem Gelände des alten Viehmarktplatzes in der Unteren Stadt gebaut (nördlich des Spitals).
Das Dachziegelwerk Möding ist mit 170 Mitarbeitern weiterhin der bedeutendste Arbeitgeber im Landkreis Landau.
Bei der Einweihungsfeier des neuen Geläutes von St. Maria stürzt die Marienglocke mit 46 Zentner aus 20 Meter Höhe in die Tiefe. Die Glocke bleibt heil, es wird auch niemand verletzt.1956
Landau bemüht sich nach Einführung der Bundeswehr vergeblich, Garnisonsstandort zu werden.
1958
In der Höckinger Straße wird im alten Weißgerberhaus aus dem 18. Jahrhundert das Heimatmuseum eröffnet. Es trägt die Handschrift des hiesigen Kaminkehrermeisters und Kreisheimatpflegers Michael Fraundorfner. Träger des neuen Museums ist der Verein „Die Förderer“.
Im Zuge der Teerung der Ludwigstraße wird der alte Ludwigsbrunnen entfernt.
Links der Isar wird in der Schlesischen Straße der zweite Kindergarten der Stadt eröffnet.1959
Mit einem Zweigwerk der Firma Triumph, die Miederwaren herstellt, kommt der erste Industriebetrieb in das neue Gewerbegebiet an der Straubinger Straße.
Mit dem Bau der „alten“ Umgehungsstraße wird begonnen. Sie führt auf dem bisherigen Hochwasserdamm in die Zanklau und in einer weiten Linkskurve hinauf bis Schreieröd.
Bereits damals ist von einer Kriechspur für den Schwerverkehr, einer dritten Isarbrücke und einer Überführung der Bahnlinie die Rede.
Das Bischöfliche Ordinariat Passau erwirbt die „Karlwiese" in unmittelbarer Nähe des Flurbereinigungsamtes für den Kirchenbau einer neu zu gründenden Pfarrei links der Isar.
Landaus Jugend bekommt einen neuen Sommertreff. Das großzügig angelegte Freibad an der Harburger Straße ist das schönste weit und breit. Es wird als „Zierde des Kreises“ gepriesen.
Der Erweiterungsbau des Hl. Geist-Bürgerspitals am Spitalplatz wird eingeweiht.1961
Der gebürtige Landauer Musikprofessor und bedeutende Komponist Arthur Piechler (1896 - 1974) erhält das Ehrenbürgerrecht der Stadt Landau.
1964
Die neue Umgehungsstraße mit der westlichen Umgehung Landaus bringt in der winkeligen Altstadt eine große Verkehrsentlastung. Die vielbefahrene B 20 führt nun außen um die Altstadt herum.
1965
Schon bei Bekanntwerden der Pläne für den Neubau der Kreissparkasse Landau in der oberen Altstadt wird im Stadtrat Kritik an dem „Betonklotz“ laut, er wird dennoch gebaut.
Grundig, eine weltbekannte Firma der Unterhaltungselektronik, nimmt mit Werk XII in Landau die Produktion auf. Grundig stellt hier Radios und Musikschränke her, nach der Devise: „ Jede halbe Minute ein Radio, jede Minute ein Musikschrank!“1966
Der Bäckermeister Hans Kick (CSU) übernimmt das Amt des Ersten Bürgermeisters, das er 18 Jahre innehaben wird.
Der Neubau der Kreisberufsschule Landau wird an der Kleegartenstraße in Betrieb genommen.1966
Auf dem Industriegelände nördlich des Bahnhofs wird die erste Produktionshalle der Firma Einhell, Inhaber Josef Thannhuber, vollendet.
Der aufstrebende Betrieb stellt Schalteranlagen, Transformatoren und Elektrogeräte her und schafft Arbeitsplätze.1967
Das Landauer Landratsamt bezieht seinen Erweiterungsbau. Fünf Jahre später muss man dies als Fehlinvestition erkennen, da das Landratsamt aus Landau nach Dingolfing abgezogen wird.
Die Landauer Nachwuchsschauspielerin Uschi Glas erhält in dem Spielfilm „Zur Sache, Schätzchen“ ihre erste Hauptrolle, nachdem sie in einem der Winnetou-Spielfilme in einer Filmnebenrolle auf sich aufmerksam machen und überzeugen konnte.
Das neue Gymnasium Landau wird mit einer Eröffnungsfeier im Parksaal aus der Taufe gehoben, das Schulgebäude selbst wird erst etwas später gebaut. Die beiden ersten Klassen werden vorläufig in der Landwirtschaftsschule und in der Mittelschule unterrichtet.
Am gleichen Tag öffnet auch die Sonderschule für Lernbehinderte in der Kleegartenstraße mit zwei Klassen erstmals ihre Pforten.
Zu Weihnachten feiert die junge katholische Gemeinde St. Johannes in einer Baracke in der Pfarrer-Huber-Straße mit Pfarrer Johann Peter einen ersten Gottesdienst.1969
Der Neubau der Kreissparkasse mit Flachdachkonstruktion wird als „ein neuer, moderner Akzent im Stadtkern“ bezeichnet, aber bald als „Verschandelung“ des historischen Stadtbildes betrachtet und später mit einem Satteldach versehen.
Für die Trinkwasserversorgung der Stadt wird für 5 Millionen DM ein Tiefbrunnen in der Kronwittau gebaut. In der Stadt herrscht ein „Wasserkrieg“, weil die Stadt durch den Bau des neuen Wasserwerks gezwungen war, den Wasserpreis schrittweise von 1 DM/m³ auf 2 DM/m³ zu erhöhen und den Haushalten eine Sonderzahlung abzuverlangen.
Der Neubau des Gymnasiums an der Harburger Straße erhält von Bischof Anton Hofmann die kirchliche Weihe. Landau hat nun alle gängigen Schularten in seinen Mauern.1971
Stadtpfarrer und Bischöflich-Geistlicher Rat Franz Sales Seidl (1904 – 1994) erhält die Ehrenbürgerwürde der Stadt Landau a.d.Isar.
Der Traktorenhersteller Eicher siedelt von Dingolfing, wo es seit 1951 produziert hatte, nach Landau um, 800 neue Arbeitsplätze werden geschaffen. Eicher bezieht eine neue Werksanlage im Norden der Stadt, in der Nähe des Grundig-Werks.
Das neue Volksschul-Gebäude im ehemaligen „Brunnergarten“ wird seiner Bestimmung übergeben. Die Grundschule und die Hauptschule sind zwar eigenständige Schulen, aber nunmehr unter einem Dach vereint.1972
Die umstrittene Gebietsreform in Bayern bringt für die Stadt Landau einen Flächenzuwachs und einen Einwohneranstieg um über 3.000 Personen. Die ehemaligen Landgemeinden Frammering, Mettenhausen, Reichersdorf und Zeholfing sowie Teile der Gemeinden Kammern und Ganacker werden in die Stadtgemeinde integriert. Sechs Jahre später sorgt die Eingemeindung der Gemeinde Höcking für ein weiteres Anwachsen der Einwohnerzahl und der Fläche. Durch die Gebietsreform verliert Landau aber seine bisherige Zentralität als Kreissitz. Kreisstadt des neugeschaffenen Landkreises Dingolfing-Landau wird Dingolfing. Landaus Zentralitätsverlust wird durch eine „Ämterdislozierung“ etwas abgemildert: Das Amtsgericht, das Forstamt, das Vermessungsamt und das Amt für Landwirtschaft bleiben in Landau, das, ebenso wie Dingolfing, den Status eines „Mittelzentrums“ zugesprochen erhält.
1973
Dem ehemaligen Direktor der Staatlichen Realschule Landau, Professor Dr. Viktor Karell
(1898 – 1979) wird die Ehrenbürgerwürde der Stadt Landau a.d.Isar verliehen.
Die „Lebenshilfe“, als Verein für den Landkreis Landau 1970 gegründet, eröffnet ihre moderne Einrichtung zur Förderung von geistig behinderten Kindern auf der Marienhöhe, am Standort des einstigen Jugendheims.1974
Das neu erbaute Feuerwehrgerätehaus an der Höckinger Straße wird seiner Bestimmung übergeben. Die Stützpunktfeuerwehr Landau ist neben der von Dingolfing die schlagkräftigste im neuen Landkreis.
Die Stadt erhält eine zweite katholische Pfarrei, St. Johannes Ev., die ihren Sprengel links der Isar hat. Pfarrer der jungen Gemeinde wird Johann Peter, der der Motor für die neue Pfarrgemeinde war und im Provisorium, der „Barackenkirche“ an der Pfarrer Huber-Straße, die Gemeinde schon vorher sammelte. An der Straubinger Straße wurde für die neue Pfarrgemeinde ein modernes Kirchengebäude mit einem funktionalen Pfarrzentrum gebaut.
Zum 750-jährigen Stadtjubiläum gestaltet der renommierte Landshuter Künstler Karl Reidel den „Ludwigsbrunnen“, der den Stadtgründer Ludwig den Kelheimer in Kupfer gegossenen zeigt. Der Brunnen findet 2001 am Dr. Schlögl-Platz seinen endgültigen Platz.1975
Der Landkreis Dingolfing-Landau baut neben dem Landauer Freibad ein schmuckes Hallenbad mit einem 25 m-Schwimmbecken als Schulsportstätte für das Gymnasium. Vier Jahre später übernimmt die Stadt das Hallenbad, das dann auch der Bevölkerung zur Verfügung steht.
1976
Die Bildhauerin Rose von Ranson (1895 – 1983) und Ehrwürdige Schwester Rufiniana Huber, ehemalige Oberin im Kreiskrankenhaus (1906 – 1994) erhalten die Ehrenbürgerwürde der Stadt Landau a.d.Isar verliehen.
1978
Die neue Kläranlage bei der Bockerlbrücke geht in Betrieb, zu einer Zeit, als selbst größere Nachbarstädte noch lange ihre Abwässer ungereinigt in die Isar einleiten.
1979
Das neue Kreiskrankenhaus am Bayerwaldring wird bezogen, es gewährleistet der hiesigen Bevölkerung eine sehr gute medizinische Grundversorgung. Die Baukosten belaufen sich auf 42 Millionen DM.
1981
Die Schließung des Grundig-Zweigwerks Landau, das bis zum letzten Tag „schwarze“ Zahlen schreibt, trifft die Stadt bis ins Mark. Trotz heftigster Proteste der Gewerkschaft, der Arbeitnehmer und der Stadtbevölkerung verlieren ca. 800 Mitarbeiter, vor allem Frauen, ihren Arbeitsplatz.
1982
In Landau bildet sich ein Verein zur Gründung einer Musikschule, die später aus finanziellen Gründen von der Stadt Landau übernommen werden sollte.
1984
Der erst 32 Jahre alte SPD-Politiker Jürgen Stadler wird überraschend neuer Bürgermeister von Landau.
Die Eicher-Werke, schon seit Jahren schwer angeschlagen, schließen wenige Jahre nach Grundig ebenfalls die Werkstore, hunderte weitere Arbeitsplätze gehen verloren. Die BMW-Werke in Dingolfing übernehmen einen Großteil der ehemaligen Eicher-Mitarbeiter.
Der Autozulieferer Dräxlmaier siedelt sich in den leeren Werkshallen der Firma Eicher an und entwickelt sich kontinuierlich zum größten Arbeitgeber der Stadt, in der Spitze beschäftigt die Firma rund 1.200 Mitarbeitern.
Der Bau der Dreifachturnhalle mit angeschlossener Tennishalle beschert Landau im Sportzentrum links der Isar eine attraktive Sportstätte.1985
Die Stadt erwirbt aus privater Hand den heruntergekommenen Kastenhof, den ehemaligen herzoglichen Amtssitz. Der historisch bedeutendste Profanbau der Stadt soll saniert und öffentlich genutzt werden.
Das Begegnungsjahr „Ungarn zu Gast in Landau“ bringt den Landauern viele hochwertige kulturelle Veranstaltungen und schafft über den Eisernen Vorhang hinweg wertvolle Kontakte. Dem ersten Begegnungsjahr folgen noch zwei weitere, mit Italien und Österreich.
Nach drei Jahren Bauzeit wird die vorletzte der geplanten Stützkraftstufen an der Isar bei Zulling fertiggestellt. Die angelegten Biotope und die großen Wasserflächen entwickeln sich in der Folge zu einem wahren Vogelparadies.1986
Landau bekommt erstmals einen Stadtbus, den „Landauer“, der im Stundentakt einen Großteil des weit auseinandergezogenen Stadtgebiets abdeckt. Er wird von der Bevölkerung von Anfang an gut angenommen.
Die Bürgerspitalstiftung zum Heiligen Geist in Landau bezieht ihr qualitätvolles, allen Ansprüchen gerecht werdendes neues Altenheim in der Dr.-Godron-Straße, am Standort des abgerissenen alten Krankenhauses.1987
Altbürgermeister Hans Kick (1917 – 2000) erhält die Ehrenbürgerwürde der Stadt Landau a.d.lsar verliehen.
Landaus überregionale Verkehrsanbindung wird durch den Neubau der A 92 München-Deggendorf mit einer eigenen Autobahnausfahrt Landau wesentlich verbessert.
Die Winzer aus der Schwesterstadt Landau in Pfalz veranstalten ihr erstes Original Pfälzer Weinfest in Landau a.d.Isar, das sich seither großer Beliebtheit erfreut.1988
Rund 40 ha werden im Nordosten Landaus als Gewerbe- und Industriegebiete ausgewiesen, um die schwache Wirtschaftskraft der Stadt zu verbessern. Die beiden Baugebiete „Landauer Wiesen“ und „Landau Nord“ entwickeln sich, trotz intensiver Vermarktungsbemühungen, zunächst nur langsam. Der neue Städtische Bauhof ist die erste Ansiedlung in den „Landauer Wiesen“ an der Kleegartenstraße.
1989
Die schon 15 Jahre alte Stadtpfarrkirche St. Johannes bekommt doch noch ihren von vielen Gemeindemitgliedern heftig geforderten Glockenturm, ein neues Wahrzeichen Landaus.
1991
Landau erhält seine dritte Isarbrücke. Die neu ausgebaute B 20, seit der Grenzöffnung zum Osten durch zunehmenden Fernverkehr belastet, führt nun nicht mehr durch den Stadtteil links der Isar, sondern westlich an der Stadt vorbei.
1992
Monsignore Anton Lideck, Krankenhausbenefiziat (1911 – 1996) erhält die Ehrenbürgerwürde der Stadt Landau a.d.Isar verliehen.
Die Erschließung des großen Wohnbaugebiets „Landau Südost“ beginnt. Nur fünf Jahre später ist die Siedlung von über 1.000 neuen Mitbürgern bewohnt.
Die Landauer Stadtkapelle wird gegründet. Sie bezieht ihren Nachwuchs aus der örtlichen Musikschule.1993
In der Nähe der Kläranlage richtet der Zweckverband Abfallwirtschaft eine Kompostieranlage und einen Wertstoffhof ein.
Die neue stützenfreie Parkgarage in zentraler Lage am Rande der oberen Altstadt bietet 220 Parkplätze, sie ist eine der letzten vom Staat geförderten Tiefgaragen. Eine wichtige Voraussetzung für die Altstadtsanierung Landaus ist geschaffen.1994
Der Betrieb der „Bockerlbahn" auf der 1903 erbauten Bahnstrecke Landau-Arnstorf wird endgültig eingestellt. Zu Beginn des Jahrhunderts war die Bahnlinie als große Errungenschaft für Landau stürmisch gefeiert worden.
1995
Im Kastenhof wird das „Niederbayerische Vorgeschichtsmuseum“ als Zweigstelle der Prähistorischen Staatssammlung eröffnet. Das Museum wird zwei Jahre später für sein modernes, die Computertechnik integrierendes Konzept mit einem Europäischen Museumspreis ausgezeichnet.
1996
Als Nachfolger von Jürgen Stadler wird der 39-jährige Volkswirt Dr. Helmut Steininger (UWG) zum Bürgermeister gewählt.
1997
An Pfingsten führen starke und anhaltende Regenfälle zu massiven Überschwemmungen in weiten Teilen des Gemeindegebiets. Das „Pfingsthochwasser“ verursacht erhebliche Schäden.
1998
Der Bau des ersten Abschnitts der sog. „Osttangente“, der den Bayerwaldring mit der Steinfelsstraße (St 2114) verbindet und ein Gehölz, das „Ludwigshölzl“, durchschneidet, beschert der Stadt den ersten Bürgerentscheid, der allerdings eindeutig zugunsten der neuen Straße ausgeht.
Die Stadthalle am Standort des ehemaligen Parkcasinos wird fertiggestellt. Das 12 Millionen-Projekt wurde von einer Bauherrengemeinschaft aus Stadt, Pfarrei St. Maria und Brauerei Krieger durchgezogen und finanziert. Die Stadt hat nun einen modernen und technisch bestens ausgestatteten Veranstaltungssaal mit hervorragender Akustik für bis zu 500 Personen.
Die Trasse der ehemaligen Lokalbahn Landau-Arnstorf wird von den Gemeinden Landau, Eichendorf, Simbach und Arnstorf erworben und zu einem attraktiven Radweg ausgebaut, der das Isartal mit dem Vilstal und dem Kollbachtal verbindet.
Der Um- und Neubau der Pfarrkirche St. Martin in Niederhöcking wird vom Regensburger Bischof Manfred Müller feierlich eingeweiht1999
Die Altstadtsanierung kommt mit der Umgestaltung der wichtigsten Straßen und Plätze, dem Oberen Stadtplatz, dem Marienplatz und der Obere Hauptstraße, entscheidend voran. Für die architektonisch anspruchsvolle Altstadtsanierung wird die Stadt später mit dem bayerischen Heimatpreis der Volks- und Raiffeisenbanken ausgezeichnet. In der Begründung heißt es: „Mit der Neugestaltung der beiden Hauptachsen der Altstadt ist der Stadt Landau eine bedeutsame Aufwertung der Stadtmitte gelungen“.
Im Norden Landaus, an der Gansmühlstraße, entsteht ein großflächiges Wohnbaugebiet, das in mehreren Abschnitten realisiert wird.Das Heimatmuseum erstrahlt nach mehrjährigem Umbau und einer Neukonzeption der Dauerausstellung in neuem Glanze.
Das Bahnhofsvorfeld wird zu einem modernen Busbahnhof für den öffentlichen Personennahverkehrs umgestaltet. Und der Parkplatz am Bahnhof wird zu einer P&R-Anlage mit 115 Stellplätzen ausgebaut.Die Firma Dräxlmaier erwirbt im Gewerbegebiet „Landau Nord“ eine 82.000 m² große Fläche und erstellt darauf eine neue Produktionshalle, über 300 neue Arbeitsplätze entstehen.
Die neu gegründete Montessori-Schule zieht in das Telekom-Gebäude am Schneiderberg ein.
Das Jubiläum „775 Jahre Stadt Landau" wird mit einer Reihe von Veranstaltungen gefeiert, deren Höhepunkte der Festakt am 28. Februar und das große Bürgerfest mit ca. 25.000 Besuchern am 18. und 19. September sind.














-
Exkurs: Nachkriegszeit in Landau
Die größten Probleme der jungen Bundesrepublik waren die hohe Zahl an Flüchtlingen und Vertriebenen, die damit einhergehende Wohnungsnot und die fehlenden Arbeitsplätze. Hatte die Bergstadt bis 1940 noch weniger als 4.000 Einwohner, so waren es in der Nachkriegszeit knapp über 6.000 Einwohner, wobei 1952 mit 6.058 der vorläufige Höchststand erreicht worden war. Von da an ging die Bevölkerung wieder leicht zurück, etliche wanderten in wirtschaftlich erschlossenere Gebiete ab. Ab 1957 überstieg die Einwohnerzahl endgültig die 6.000 er-Marke. Analog entwickelte sich die Einwohnerzahl im Landkreis Landau, sie stieg von ca. 25.000 im Jahre 1939 auf über 37.000 im Jahre 1951, davon waren über 12.000 Flüchtlinge oder Vertriebene.
Der katastrophale Wohnungsmangel zwang in Landau dazu, auf „Ersatzwohnungen“ in Form von Baracken zurückzugreifen, die letzte sollte erst 1969 aus dem Stadtbild verschwinden.
Schon bevor der Bundestag 1950 das 1. Wohnungsbaugesetz erließ, kam der Wohnungsbau in Landau in Gang. Der Bauverein stellte schon 1949 in der Marbstraße die ersten sechs Neubauten fertig. Es folgten 1950 und 1951 weitere Häuser am Schneiderberg, an der Leonhart-, der Buchner- und der Fritz Kollmann-Straße. 1951 begann der Wohnungsbau auch links der Isar, an der Damm-, der Arco- und der Pfarrer-Huber-Straße, nachdem der Standort des Flurbereinigungsamtes feststand. Der neue Stadtteil links der Isar begann, sich zu entwickeln.
Bis Ende der 50er Jahre waren Landau und sein Umland rein landwirtschaftlich geprägt. Die Ansiedlung von industriellen Betrieben ließ lange auf sich warten. So fehlten Tausende von Arbeitsplätzen. Die Flüchtlinge suchten deshalb zunächst Arbeit bei den Bauern. Im Juli 1949 war von den 2.740 Landauer Flüchtlingen knapp die Hälfte in der Landwirtschaft tätig.
Der damalige 1. Bürgermeister Josef Haufellner charakterisierte die Zeit der frühen 50er Jahre treffend so: „Wir stehen vor ganz neuen wirtschaftlichen und sozialen Problemen. An diese schwierigen Aufgaben müssen wir herangehen mit der Erkenntnis, dass wir alle, Einheimische und Flüchtlinge, aufeinander angewiesen und gleichermaßen von der gesunden wirtschaftlichen Gesamtentwicklung der Stadt abhängig sind.“
1950 stand das neue Rathaus zwar zur Einweihung bereit, die gesprengte Isarbrücke war dagegen noch immer nicht wiederhergestellt. Dennoch machte sich in der Bergstadt so etwas wie Aufbruchsstimmung breit, das alltägliche Leben normalisierte sich, Vereine reorganisierten sich, und der gemeinnützige sowie der private Wohnungsbau setzten langsam ein.
Den Beinamen „Bergstadt“ führte Landau bis 1950 noch mit Fug und Recht. In der Ebene links der Isar gab es nämlich noch fast keine Besiedlung. Lediglich entlang der Straubinger Straße und der Baderallee, auf dem direkten Weg zum Bahnhof, standen vereinzelt Häuser. „Draußen vor der Stadt“ gab es sonst nur saure Wiesen, Wassertümpel und Buschwerk wie die Flurnamen „Grieß“, „Froschau“, „Schwaige“ und „Moos“ deutlich zeigen. Die ständig wiederkehrenden Isarhochwasser waren trotz eines vorhandenen Dammes eine dauernde, nie ganz zu bannende Gefahr für diese Gebiete.
Trotzdem wählten viele Flüchtlinge gerade dieses Gebiet zu ihrer zweiten Heimat und siedelten hier. Das ebene Areal bot günstige und zentrumsnahe Baugründe. Ganze Straßenzüge wurden in der Folgezeit hier angelegt und bevölkert. Die Pfarrer-Huber-Straße ist ein beredtes Zeugnis jener Zeit für den Bauboom im Norden der Stadt.
Auffällig für einen Auswärtigen waren seinerzeit (und sind es heute noch) die vielen Gastwirtschaften in der Altstadt. Soweit man zurückdenken kann, waren es immer an die 30, so auch um 1960. Von den ehemals 14 Brauereien im 18. Jahrhundert war nach dem 1. Weltkrieg allerdings nur der Krieger-Bräu übriggeblieben.
Wortführer im politischen und gesellschaftlichen Leben der Stadt waren die alteingesessenen Handwerker und die Vieh- und Getreidehändler. Um die eigenen Positionen zu verteidigen, standen einflussreiche Persönlichkeiten einer Öffnung der Stadt für Gewerbeansiedelungen oder die Errichtung eines „Fluramtes“ negativ gegenüber. „Da kommen so viele G`studierte auf Landau, die brauch ma net“, so hörte man die Parole am Biertisch.
Bis zur Gebietsreform 1972 blieb Landau Kreisstadt mit kleinstädtischem, ländlichem Charme. Die wichtigsten Ämter, Landratsamt, Finanzamt, Vermessungsamt und Amtsgericht, befanden sich innerhalb der Landauer Mauern und gewährleisteten regionale Zentralität. Was nach 1950 aber dringend fehlte, waren Arbeitsplätze. Beschäftigung gab es nur in der Landwirtschaft. Die bedeutendste industrielle Produktionsstätte des Landkreises war, wie schon seit Jahrzehnten, das Dachziegelwerk Möding. Das entstehende Fluramt war im Hinblick auf die neuen Arbeitsplätze ein Segen für die ganze Region.
In der Herstellung elektromedizinischer Geräte hatte die Firma Janus einen guten Ruf, sie exportierte auch ins Ausland. Zu ihr gesellten sich bald die Strickwarenfabrik Sebastian Beer, die Strumpffabrik Reinhard Schultz und das Zweigwerk der Firma Triumph (Miederwaren). Zu größeren Holzverarbeitungsbetrieben entwickelten sich die Firmen Righi und Marek. Heute gibt es in der Stadt keine mehr der damals so hoffnungsvoll gestarteten Firmen.
-
21. Jahrhundert
2000
An der Isarbrücke entsteht ein zweiter Kreisverkehr an der Einmündung der alten Umgehungsstraße in die Hauptstraße. Auch die Kreuzung der Straubinger Straße mit der DGF 3 im Landauer Moos soll als Gefahrenstelle durch einen Kreisverkehr entschärft werden, der sich bereits in Planung befindet.
An der Gansmühlstraße erschließt die Stadt ein Baugebiet im Bereich links der Isar, das eine lange, für dort geforderte Wohnbebauung ermöglicht.
Das Bauprojekt "Isarturm“ mit dem markanten zentralen Turmbau wird in der Unteren Stadt realisiert.
Nach dem „Pfingsthochwasser" von 1999 werden die notwendigen Schutzmaßnahmen im ganzen Stadtgebiet im Rahmen des aufgestellten Hochwasserschutzprogramms abgeschlossen: mehrere Regenrückhaltebecken, Entlastungskanäle und Hochwasserschutzdämme bei Bächen im ländlichen Bereich.
Mit viel Eigenleistung und Idealismus wird an einem schön gelegenen Aussichtspunkt am Bockerlbahnradweg, hoch über der Isar, die von Toni Waas initiierte Josefskapelle fertiggestellt.2001
Der jahrelang schon abgebaute Ludwigsbrunnen, der zum 750 jährigen Stadtjubiläum 1974, vom renommierten Landshuter Künstler Karl Reidel in Kupfer gegossen und umgestaltet wurde, kommt am Kreisverkehr an der Harburger Straße wieder zur Aufstellung.
„Mit der Neugestaltung der beiden Hauptachsen der Altstadt ist der Stadt Landau eine bedeutsame Aufwertung der Stadtmitte gelungen“, heißt es in der Begründung des bayerischen Heimatspreises, mit dem die Stadt für die abgeschlossene Altstadtsanierung ausgezeichnet wird.
Für den geplanten betreuten Jugendtreff sollen im Bahnhofsgebäude Landau Räume angemietet werden, was bei den schwierigen Verhandlungen mit der DB nicht auf Anhieb gelingt.
Die Dachziegelwerke Möding stellen einen Insolvenzantrag und zum Jahresende die Produktion ein. Es handelt sich bei dem ehemaligen Ziegeleibetrieb Gerhaher um den ältesten und einst größten Industriebetrieb im Bereich des Altlandkreises Landau.
Die Stadt Landau wird von einer wohlhabenden Bürgerin als Alleinerbin eingesetzt. Bei dem vermachten Vermögen handelt es sich um einen Millionenbetrag.
Die Pfarrkirche in Zeholfing erstrahlt nach einer gelungenen Generalssanierung in neuem Glanze.2002
An der Hauptschule Landau wird eine Ganztagsbetreuung eingerichtet.
Bei der Gansmühle wird durch den bayerischen Staatsminister für Landwirtschaft und Forsten, Josef Miller der erste Spatenstich für eine Aufstiegshilfe für Fische im Gansmühlbach gemacht.
Professor Dr. h.c. Reinhold Würth hält im Kastenhof Landau einen Festvortrag über Maler der Moderne und eröffnet die Ausstellung mit Bildern von Günter Grass.2003
In Landau wird ein Hospizverein gegründet. Der Verein wächst in den folgenden Jahren erfreulich. Mitbürger kümmern sich ehrenamtlich und vorbildlich um Menschen, die an der Grenze ihres Lebens stehen.
Die Stadt hält erstmals einen Neubürger-Empfang ab, bei dem sich die Stadt mit den Dienstleistungen der Stadtverwaltung, ihren Repräsentanten und dem Angebot an Vereinen und Institutionen präsentiert.
„Bayerns schönste Geotope" werden mit einem Gütesiegel des Freistaates ausgezeichnet. An Platz 19 der 100 ausgezeichneten Geotope Bayerns steht der "Wachsende Felsen" von Usterling. Durch seine ideale Lage am Isar-Radwanderweg und überregionale Werbung erhält er immer mehr Besucher.
Die Stadt will sich zukünftig verstärkt mit dem Thema "Belebung der Altstadt" auseinandersetzen und für die Entwicklung in diesem Bereich qualitative Wohnungen sowie dazu notwendige Versorger und Dienstleister bereitstellen.
Das seit über 100 Jahren bestehende Forstamt Landau soll bei der geplanten bayerischen Verwaltungsreform wegfallen.
Auch die Direktion für ländliche Entwicklung (Flurbereinigungsdirektion für Niederbayern) steht vor einschneidenden Veränderungen. Mit Personalabbau wird gerechnet.2004
In Niederhöcking beginnen nach einer langen Phase der Planungen die durchzuführenden Maßnahmen für die Dorferneuerung.
Die Stadtwerke Landau übernehmen von EON die Gasversorgung für das Stadtgebiet Landau.
Im Arbeitsamt Landau wird eine Arbeitsgemeinschaft zur Bewältigung der Hartz IV- Anforderungen eingerichtet.
In der chirurgischen Abteilung des Kreiskrankenhauses Landau wird ein Facharzt für Handchirurgie installiert.
Die Ausstellung “Tiere der Eiszeit“ lockt über 14.000 Besucher in den Kastenhof, das Niederbayerische Vorgeschichtsmuseum.
Des 700. Jahrestags der Aushändigung der Landauer Stadtrechtsurkunde (1304) und des Jahres des Niederbayerischen Erbfolgekrieg von 1504, der Landau den ersten verheerenden Stadtbrand bescherte, gedachte die Stadt in einem feierlichen Gottesdienst mit Altbischof Franz X. Eder in der Stadtpfarrkirche Sankt Maria.
Der Kindergarten Maria Ward, der älteste im Stadtbereich Landau, wird von den Englischen Fräulein offiziell der Stadt Landau übergeben.2005
Der Jahrestag "60 Jahre Kriegsende“ wird mit einer Ausstellung im Heimatmuseum, einer Gedenkfeier am Marienbrunnen und mit einer Zeitzeugen-Talkrunde begangen.
Für Belange des Altenheims der Heiliggeist- Bürgerspitalstiftung wird aus den Reihen des Helferkreises ein „Förderverein Altenheim Landau“ gegründet.
Auf dem Volksfestplatz gastiert der Zirkus Krone.
Die Englischen Fräulein, die ehrwürdigen Schwestern der Congregation Jesu (CJ), ziehen sich nach 146 Jahren segensreicher Tätigkeit in der Kindererziehung und der Schule mangels Nachwuchses aus der Bergstadt zurück.
Mit dem Anschluss der Ortschaften Kleegarten, Zulling, Usterling und Dietlsberg sind mehr als 90 % aller Häuser im Stadtgebiet an die städtische Kläranlage angeschlossen.
Für die Jugend der Stadt wird ein Skaterpark bei McDonald geschaffen, für Freunde der Astronomie ein Planetenwanderweg angelegt.
Die “Herbergssuche“ in der Stadt Landau zur Adventszeit begleiten mehr als 1000 Besucher, ebenso wie die „lebendige Krippe“ kurz vor Weihnachten im Reithmeier - Anwesen im Stadtgrabensehr großen Zuspruch findet.2006
Die interkommunale Zusammenarbeit mit Nachbargemeinden, das Xperregio-Projekt, dem die Stadt Landau als größte Gemeinde angehört, entwickelt als kommunaler Verbund eine eigene Wirtschaftsförderung, gesteuert durch ein regionales Management.
Die Schulden der Stadt werden im Laufe des Jahres um 2 Millionen zurückgefahren, die der Stadtwerke um die gleiche Summe. Gleichzeitig werden die Rücklagemittel der Stadt um 1,5 Millionen aufgestockt.
Es gelingt die Kaufkraftbindung der Stadt Landau durch Ansiedelung von Verkaufsmärkten und Geschäften (Baumarkt und Lebensmittelmärkte) weiter zu erhöhen und gegen 80 bis 90 % zu führen.2007
Der Spatenstich für den Neubau der Stadtwerke-Verwaltung am Standort des ehemaligen Klosters der Englischen Fräulein wird getan.
Das Postamt in Landau in der Höckinger Straße wird geschlossen und eine Postagentur eröffnet.
In Niederhöcking wird der neue Dorfplatz mit Kapelle, Radweg und Kindergarten - Spielplatz eingeweiht.
Über die Zukunft des Kreiskrankenhauses Landau. Sogar über eine Schließung, wird diskutiert.
Der Friedhof in Landau geht aus kirchlicher Trägerschaft in städtische Hand über. Dabei sind im Friedhofsbereich mit Leichenhaus ca. 500.000 € zu investieren.
Die Stadt Landau will das Projekt "Grüne Mitte", die Neugestaltung des rechten Isarufers zwischen der Isarbrücke und Zulling, angehen. Schwerpunkte sind die Verbesserung der Hochwassersituation, ökologische Maßnahmen und Erhöhung des Freizeitwertes.
Die Altstadtsanierung wird mit der Planung für das Quartier Ludwigstraße/obere Hauptstraße weitergeführt. Ziel ist eine durchgehende fußläufige Verbindung zwischen beiden Straßen, die Schaffung von Parkplätzen und die Erhöhung der Wohn- und Aufenthaltsqualität im Bereich der oberen Altstadt.
Ein Sozialkaufhaus im Stadtbereich links der Isar bietet für 50 Hartz IV - Empfänger die Möglichkeit, durch Weiterbildung wieder im normalen Arbeitsmarkt Beschäftigung zu finden, sowie preisgünstig einzukaufen.
Die Stadt Landau beabsichtigt eine bedarfsgerechte Kinderbetreuung einzurichten, die von der Kinderkrippe über den Kindergarten bis hin zum Kinderhort führt.2008
Die Stadt Landau feiert das hundertjährige Bestehen der eisernen Isarbrücke mit einem historischen Festzug am Volksfestsonntag. An der "Zeitreise über die Brücke" zeigen sich über 5000 Menschen interessiert.
Der Spatenstich zum Bau der Quartiersgarage Ludwigstraße/Obere Hauptstraße mit 92 Stellplätzen erfolgt. Die Baukosten werden nicht über den Staatshaushalt, sondern über den Wirtschaftsplan der Stadtwerke abgewickelt.
Das neue Gebäude der Stadtwerke Landau am Maria-Ward-Platz wird eingeweiht.
Ein zweites Altenpflegeheim mit einem privaten Träger wird in Krankenhausnähe errichtet.2009
Zum fünfzigjährigen Bestehen des Freibades Landau wird ein Freibadfest veranstaltet.
Die Sendung “Jetzt red i" des Bayerischen Rundfunks, in der Bürger ihre Anliegen vorbringen können, wird dem Wirtshaus Schachtner in Oberhöcking aufgezeichnet.
Die Radlertour des Bayerischen Rundfunks, die “BR-Radlertour" mit 1.100 Teilnehmern macht am Marienplatz Station.
Die "Arnstorfer Tafel", die Lebensmittel für Bedürftige verteilt, bezieht ihre Räume in der Ludwigsstraße. Sie arbeitet mit Partnern zusammen, die etwas gegen Hunger haben.
Am "Wachsenden Felsen" in Usterling, dem touristischen Highlight in unserem Landkreis, wird eine öffentliche Toilettenanlage erforderlich.
Der steigende Verkehrslärm an der B 20 soll durch eine Lärmschutzwand gemildert werden. Die Forderung der Anwohner wird immer lauter.2010
Durch Mittel des Konjunkturpakets II kann der Energieverbrauch im Hallenbad um 30 Prozent gesenkt werden.
Das Kaufhaus "Real" am Viehmarktplatz wird endgültig geschlossen. Es ist keine Nachfolgelösung in Sicht.
Die Errichtung eines Lebensmittelmarktes (Edeka) an der Hochstraße zur Versorgung der Innenstadtbevölkerung mit Grundnahrungsmitteln wird auf den Weg gebracht.
Für das laufende Jahr wird mit einem deutlichen Rückgang der Gewerbesteuer und der Einkommensteuerbeteiligung, in Folge der zurückliegenden schlechten Wirtschaftslage, gerechnet.
Als letzte Ortschaften des Stadtgebietes werden Weihern und Thanhöcking an das öffentliche Kanalnetz der Stadt angeschlossen.
Das 100jährige Bestehen der Landauer Schäffler feiern Schäfflergruppen aus Ober- und Niederbayern gemeinsam in Landau. Nur die Schäffler aus der Landeshauptstadt München, die die Landauer einst zum Vorbild nahmen, fehlten.2011
Die Reichersdorfer Weihnacht mit dem legendären „Christkindl vo' Reichersdorf“ ist ein stimmungsvoller dörflicher Weihnachtsmarkt am dortigen Kirchplatz.
Mit den Hauptschulen Wallersdorf, Pilsting, Reisbach und Simbach wird ein Schulverbund Landau zur Errichtung einer Mittelschule gegründet.
Der Verein „Förderer e. V.“, der sich als Kulturverein versteht, feiert sein hundertjähriges Bestehen.
Die Katastrophe in Fukushima (Japan), mit den Folgen des Tsunamis, stellt den Nutzen der Kernenergie weltweit infrage und führt zur Energiewende bis hinein in die kleinste Gemeinde.
Die Arbeitslosigkeit liegt in unserer Region zurzeit bei ca. 2,1 Prozent.2012
Am Landauer Kneipenfestival des TV Landau beteiligen sich 14 Kneipen und 14 Bands.
Die Dorferneuerung Niederhöcking wird mit der Einweihung eines Denkmals und mit einer Feier abgeschlossen.
Am Marienplatz wird wieder ein Kino, das „Kuki“ (Kultkino), eröffnet.
Der Bau einer Kindertagesstätte mit Platz für 104 Kinder am Bayerwaldring wird begonnen.
Der Umbau des Rathauses in ein modernes Verwaltungsgebäude steht vor dem Abschluss.
Die "Hackervilla" in der Straubinger Straße steigert die Attraktivität Landaus als Einkaufsstadt.
Die Versorgung mit schnellem Internet und Breitband wird als notwendig für den Standort Landau erkannt. Lösungen lassen aber auf sich warten.
Die Montessori Schule soll in die zwei Gebäude der ehemaligen Knabenvolksschule in der unteren Fleischgasse umziehen, die von der VHS und dem Kindergarten "Friedenskirche" genutzt wird. Für ein neues VHS - Gebäude in der Ludwigstraße läuft bereits ein Architektenwettbewerb.
Das 150jährige Jubiläum des TV Landau wird groß gefeiert. Die Feierlichkeiten ziehen sich das ganze Jahr hindurch.
Die Kreistage der Landkreise Deggendorf und Dingolfing-Landau stimmen mit großer Mehrheit einer Fusion der drei Krankenhäuser Deggendorf, Dingolfing und Landau zum Donau-Isar-Klinikum zu. Im Landauer Haus wird in den nächsten Jahren eine Generalsanierung durchgeführt.2013
Zum Gedenken an den Pestausbruch vor 300 Jahren (1713) veranstalten Stadt und katholische Kirche das ganze Jahr über Veranstaltungen, deren Höhepunkt das Pestspiel "Noth lehrt beten", am Oberen Stadtplatz mit über 100 Beteiligten und über 1.000 Zuschauern, ist.
Das Dorf Niederhöcking wird Kreis Sieger in dem Wettbewerb "Unser Dorf soll schöner werden".
Die Freiwillige Feuerwehr Landau feiert in großem Rahmen ihr 150jähriges Gründungsfest.
An der Straubinger Straße entsteht Niederbayerns größter und modernster Getränkemarkt.
Im Stadtgebiet werden derzeit über 1100 Photovoltaik- und 8 Biogasanlagen betrieben, die ca. 70 Prozent der benötigten Energie erzeugen.
Mit der Verkehrsfreigabe des neugestalteten Dorfplatzes, mit Buswendebereich und Denkmal, erlebt die Teilnehmergemeinschaft Dorferneuerung Fichtheim zum Jahresende den Abschluss des Verfahrens. Die Kosten belaufen sich auf 450.000 Euro.
Das Kinderhaus der evangelischen Friedenskirche Landau, das "Kinderhaus-Spielraum", wird am Bayerwaldring eröffnet. Es wird ein nach neuesten pädagogischen Erkenntnissen erstelltes Raum- und Bewegungskonzept umgesetzt.2014
Der Discounter "Kaufland" baut an der Straubinger Straße, wofür der dritte Kreisverkehr in Landau am Wiesenweg als Zufahrt entsteht.
Die Pfarrei St. Johannes Ev. feiert ihr 40jähriges Bestehen mit einem feierlichen Dankgottesdienst, einer großen Fotoausstellung und einem Pfarrfamilienabend mit Dokumentarfilm.
Die "Hotelqualität" im Landauer Krankenhaus wird stationsweise verbessert, der Aufnahmebereich neu konzipiert und gestaltet und zwei Operationssäle nach modernstem Stand gebaut und eingerichtet.
Am Soldatenfriedhof in Heiligkreuz wird des Beginns des 2. Weltkriegs (1.Sept.1939) vor 75 Jahren gedacht.2015
Das "Niederbayerische Archäologiemuseum" im Kastenhof wird aus dem Verbund mit der Archäologischen Staatssammlung München herausgelöst und mit verkleinerter Ausstellungsfläche und reduzierten Öffnungszeiten als nichtstaatliches Museum weitergeführt.
Der "Herzogsaal" des Kastenhofes, über den historischen Gerichtssälen gelegen, wird von der Stadt als repräsentatives Trauungszimmer für große Hochzeitsgesellschaften gewidmet und genutzt.
Die Generalsanierung des bisherigen Kindergartens "Regenbogenland" und der Anbau einer neuen Kinderkrippe werden abgeschlossen und ihrer Bestimmung feierlich übergeben. Die VHS Landau, die bisher im alten Knabenschulhaus an der Fleischgasse untergebracht war, kann ihren Neubau in der Ludwigstraße beziehen, der in das Ensemble der Oberen Altstadt eingepasst wurde. Er soll ein wichtiger Baustein sein bei der Sanierung der Altstadt und der "Wiederbelebung" der Ludwigstraße.
Mit Schuljahresbeginn 2015/16 kann die private Montessori-Schule mit ihren Grundschülern in den ehemaligen evangelischen Kindergarten und ihren Hauptschülern in das ehemalige VHS-Gebäude einziehen. Das von der Stadt neuerstellte Fachgebäude wird gleichzeitig dem Schulbetrieb übergeben. Die staatlich geförderte Altstadtsanierung der Obern Stadt erreicht an der Hauptstraße die Kurve beim Gasthof "Post". Gleichzeitig wird die Sanierung der Straubinger Straße zwischen Isarbrücke und Kreisverkehr bei der Kirche St. Johannes Ev. begonnen.
Die bereits 1986 beantragte Dorferneuerung für die östlichen Ortsteile der Stadt Kleegarten-Poldering-Zeholfing kommt mit der Bildung von Arbeitskreisen unter der Steuerung des Amtes für Ländliche Entwicklung (ALE) Landau in Fahrt.2016
Die Deutsche Telekom legt Glasfaserleitungen zu den Kabelverzweigern im Stadtgebiet und in die größeren Dörfer. Dadurch erhalten rund 6.000 Haushalte im Stadtgebiet eine Datengeschwindigkeit von mindestens 30 Mbit/s.
2017
Das Landauer Gymnasium feiert 50-jähriges Bestehen. Höhepunkt des Jubiläumsjahres ist ein Festakt mit über 1000 Ehemaligen. Die neue Tartanbahn am Gymnasium wird fertiggestellt. Das Donau-Isar-Klinikum eröffnet in Landau Niederbayerns erste Geriatrische Tagesklinik.
2018
Der erste Spatenstich für die Erweiterung der Kläranlage wird gesetzt, die Baumaßnahme dauert bis 2020 und kostet 3,9 Millionen Euro. Die Gruppe „Landau im Wandel“ legt einen Gemeinschaftsgarten über der Quartiersgarage an.
2019
Die Altstadtsanierung von der Isarbrücke bis zum Kreisverkehr Harburger Straße wird abgeschlossen. Die Straubinger Straße wird damit zur Allee.
Die Stadt stellt einen Jugendsozialarbeiter ein, der sich um sozial benachteiligte Jugendliche im Stadtgebiet kümmert und den „Jugendtreff“ im Bahnhof betreut.
Der im September des Jahres eröffnete Mehrgenerationenpark, am Rand der oberen Altstadt gelegen und direkt an das Städtische Altenheim angrenzend, ist eine wertvolle Grünfläche im Stadtinnern. Die einladend gestaltete, schattige Parkanlage besitzt verschiedene Spielmöglichkeiten für Kinder sowie eine Kneipp- Anlage und eine Boccia- Bahn, auch Rastplätze unter großen Bäumen für Erwachsene und Senioren.
Das Archäologiemuseum im historischen Kastenhof erlebt eine Neukonzeption der Dauerausstellung zu einem speziell auf die Jungsteinzeit fokussierten Museum mit Erlebnischarakter, das die Auswirkung der Entwicklungen in dieser wichtigen Epoche der Menschheitsgeschichte bis in die Gegenwart herein vor Augen führt. Von Anfang an erfreut sich der am Volksfestplatz bereitgestellte Jugendfreizeitplatz mit angegliedertem Skaterplatz durch seine Vielzahl an modernen Openair-Sportgeräten einer großen Beliebtheit bei Jugendlichen, Kindern und jungen Familien.2020
Der 1. Bauabschnitt der Altstadtsanierung untere Stadt wird abgeschlossen. Er umfasst den Bereich von der Isarbrücke bis zur Spitalkirche. Erreicht wird die optische Verbesserung der Eingangssituation in die Altstadt, der Lärmreduzierung durch einen neuen leisen Straßenbelag und die Gestaltung des historischen Lager- und Stapelplatzes vor der Brücke.
Die für Landau so wertvolle Isarrenaturierung „Flusserlebnis Isar“ als bedeutende Umweltmaßnahme im Abschnitt Zulling und Landau wird abgeschlossen. Die Isar ist wieder als Alpenfluss für Wanderer und Radfahrer erlebbar. Es handelt sich um ein von der EU gefördertes großes LIFE-Naturprojekt.
Wegen der fast das gesamte Jahr beherrschenden Corona-Pandemie können weder das Landauer Weinfest mit Winzern aus Landau/Pfalz (seit 1987) um Christi Himmelfahrt noch das beliebte Landauer Volksfest um den Peter- und Paulstag (29. Juni) in herkömmlicher Form durchgeführt werden, die allermeisten Traditionstermine müssen entfallen.
2021Das neue hochmoderne Hochregallager der „Einhell Germany AG“ am Wiesenweg ist mit seiner Länge von 130 Metern und seiner Höhe von 48 Metern das größte Gebäude der Stadt. Es kann 50.000 Paletten in 17 Ebenen lagern. Nur der Kirchturm von St. Maria und das Voglmaier-Silo in Bahnhofsnähe sind in Landau höher.
Das neukonzipierte „Museum für Steinzeit und Gegenwart“ im Kastenhof beginnt seine Ausstellungsreihe mit der Wanderausstellung „Holz macht Sachen“. Es geht dabei um die jahrtausendealte Verbindung des Menschen mit dem Wald, den Bäumen und dem Holz.
2022Die „Kunsteisbahn Landau“ im Freibadgelände wird offiziell eröffnet. Mit diesem attraktiven Freizeitangebot für Eisläufer und Eisstockschützen geht in Landau ein Jahrhunderttraum in Erfüllung: Landau bekommt seine lang ersehnte Eisbahn. Schon vor mehr als hundert Jahren, im Winter 1913, wurde in der Zanklau behelfsmäßig eine stadtnahe Natureislaufbahn von der Bevölkerung gefordert, errichtet und eifrig genutzt.
Bezug des vom Landkreis neu gebauten, pädagogisch höchsten Ansprüchen und hohen Umweltstandards entsprechenden Förderzentrums der Pfarrer-Huber-Schule Landau an der Kleegartenstraße. Es wird zu Jahresbeginn vom Landkreis der Schule übergeben und von Insidern als „derzeit modernstes Schulhaus Europas“ bezeichnet. Der Landrat spricht stolz von einer „Ausstattung mit allen technischen und digitalen Finessen.“
Der Werkzeugbauer „Einhell“ hat 2021 zum wiederholten Male seinen Umsatzrekord aus dem Vorjahr überboten und will 2022 die „Milliarden-Euro-Schallmauer“ trotz Corona-Pandemie und möglicher Lieferengpässe knacken.
Nachdem das im Jahre 1977 fertiggestellte Lebenshilfe-Gebäude auf der Marienhöhe zum Schuljahresbeginn 2021/22 wegen baulicher Mängel unverzüglich geschlossen werden musste, wurden die Schüler notdürftig auf fünf verschiedene Standorte in Landau und Pilsting verteilt. Da der Neubau der Lebenshilfe an der Härtlstraße in Landau sich weiter verzögert, wird der nun leerstehende Altbestand der Pfarrer-Huber-Schule als Übergangslösung für die Lebenshilfe-Einrichtung Dingolfing-Landau sinnvoll genutzt.
Copyright: Nik Söltl